 Lourdes,
der bekannte Marienwallfahrtsort in
Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,
die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,
Probleme haben, leiden, neugierig sind oder
einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte
besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie
gehört haben, dass dort die Gottesmutter
erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort
für sie näher als sonst wo, nicht
zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche
lassen sich nämlich gerne von der
Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr
sicher und geborgen und erfahren sich auch in
ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon
immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben
zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an
Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt
an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor
das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag
Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen
verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit
heraus entwickelt.
Lourdes,
der bekannte Marienwallfahrtsort in
Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,
die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,
Probleme haben, leiden, neugierig sind oder
einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte
besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie
gehört haben, dass dort die Gottesmutter
erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort
für sie näher als sonst wo, nicht
zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche
lassen sich nämlich gerne von der
Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr
sicher und geborgen und erfahren sich auch in
ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon
immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben
zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an
Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt
an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor
das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag
Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen
verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit
heraus entwickelt.
Am Anfang dieses Gedenktags steht das
Ereignis der Marienerscheinung an ein
vierzehnjähriges Hirtenmädchen,
Bernadette Soubirous, in einer Felsgrotte bei
Lourdes am 11. Februar 1858. In der Vision des
Mädchens soll sich die „Dame“, wie Bernadette
die Erscheinung genannt hat, als „die unbefleckte
Empfängnis“ vorgestellt haben. Das
Mädchen hatte noch weitere 17 Visionen bis
16. Juli desselben Jahres. Die Massabielle-Grotte
wurde seitdem zur Pilgerstätte
unzähliger Menschen aus nah und fern. Papst
Leo XIII. erlaubte 1890 den Diözesen
Frankreichs den 11. Februar als Erscheinungsfest
der Unbefleckten Jungfrau Maria zu feiern.
Dieses Fest wurde dann 1908 vom Pius X. auf die
ganze römische Kirche ausgedehnt. Die
Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen Konzil
hat dieses Fest zu einem freien Gedenktag gemacht.
Damit wollte man betonen, dass die Gottesmutter
und ihre Erscheinung als historische Tatsache den
Gegenstand dieser Feier bilden. Seitdem trägt
dieser Gedenktag den Namen „Unsere lieben Frau in
Lourdes“. Da diese Feier aber an einen Ort bzw. an
einen privaten Bereich gebunden ist und somit
einen Volksfrömmigkeitscharakter hat, wird
das liturgische Begehen dieses Gedenktags der
freien Wahl der Ortskirchen überlassen.
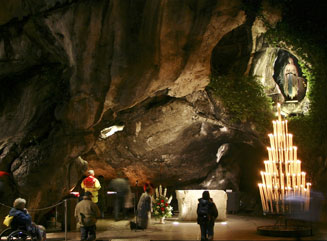 In der
Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die
Liturgie Maria als Fürsprecherin in den
Vordergrund, weil sie im Volke als solche am
meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist
bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen
ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld
bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit
des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus
dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die
heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder
Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost
und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne
gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich
vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.
Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist
der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der
Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh
2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als
Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,
nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht
auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:
„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden
Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria
kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und
sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache
erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit
zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube
beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen
Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben
keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre
Fürsprache. Dann wendet sie sich an die
Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –
Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze
sind auch die einzigen, welche Maria im
Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie
in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die
Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen
Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.
Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das
Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen
vom ersten Wunder, das Jesus auf die
Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das
Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser
zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger
in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn
glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe
erfüllt, weshalb sie sich dann
zurückzieht. In diesem Punkt liegt
schließlich auch die Botschaft dieses
Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus
erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich
selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus
und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In
dieser Haltung verbirgt sich die Größe
Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der
Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es
blieb unbefleckt.
In der
Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die
Liturgie Maria als Fürsprecherin in den
Vordergrund, weil sie im Volke als solche am
meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist
bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen
ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld
bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit
des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus
dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die
heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder
Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost
und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne
gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich
vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.
Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist
der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der
Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh
2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als
Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,
nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht
auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:
„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden
Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria
kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und
sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache
erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit
zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube
beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen
Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben
keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre
Fürsprache. Dann wendet sie sich an die
Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –
Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze
sind auch die einzigen, welche Maria im
Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie
in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die
Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen
Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.
Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das
Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen
vom ersten Wunder, das Jesus auf die
Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das
Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser
zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger
in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn
glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe
erfüllt, weshalb sie sich dann
zurückzieht. In diesem Punkt liegt
schließlich auch die Botschaft dieses
Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus
erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich
selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus
und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In
dieser Haltung verbirgt sich die Größe
Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der
Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es
blieb unbefleckt.
fr. Fero M.
Bachorík OSM

![]()
 Lourdes,
der bekannte Marienwallfahrtsort in
Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,
die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,
Probleme haben, leiden, neugierig sind oder
einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte
besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie
gehört haben, dass dort die Gottesmutter
erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort
für sie näher als sonst wo, nicht
zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche
lassen sich nämlich gerne von der
Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr
sicher und geborgen und erfahren sich auch in
ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon
immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben
zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an
Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt
an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor
das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag
Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen
verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit
heraus entwickelt.
Lourdes,
der bekannte Marienwallfahrtsort in
Südfrankreich, zieht seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts Menschen aus aller Welt an: Menschen,
die an Gott glauben, Maria verehren, Trost suchen,
Probleme haben, leiden, neugierig sind oder
einfach nur gerne reisen oder berühmte Orte
besuchen. Viele jedoch gehen hin, weil sie
gehört haben, dass dort die Gottesmutter
erschienen ist. Demnach ist Gott an diesem Ort
für sie näher als sonst wo, nicht
zuletzt, weil sie hier nicht alleine sind. Manche
lassen sich nämlich gerne von der
Menschenmenge tragen und fühlen sich in ihr
sicher und geborgen und erfahren sich auch in
ihrem Glauben gestärkt. Der Mensch hat schon
immer Orte gebraucht, an denen er seinen Glauben
zum Ausdruck bringen konnte: in den Kirchen, an
Wallfahrtsorten... Aber nicht nur das. Er bringt
an diese Orte auch viele Anliegen mit, um sie vor
das Gnadenbild Mariens zu legen. Der Gedenktag
Unserer lieben Frau in Lourdes hat sich aus diesen
verschiedenen Aspekten der Volksfrömmigkeit
heraus entwickelt.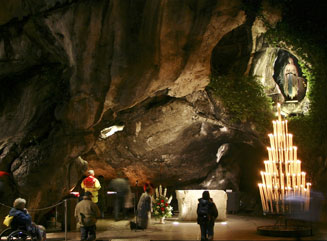 In der
Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die
Liturgie Maria als Fürsprecherin in den
Vordergrund, weil sie im Volke als solche am
meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist
bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen
ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld
bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit
des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus
dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die
heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder
Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost
und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne
gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich
vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.
Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist
der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der
Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh
2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als
Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,
nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht
auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:
„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden
Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria
kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und
sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache
erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit
zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube
beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen
Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben
keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre
Fürsprache. Dann wendet sie sich an die
Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –
Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze
sind auch die einzigen, welche Maria im
Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie
in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die
Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen
Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.
Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das
Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen
vom ersten Wunder, das Jesus auf die
Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das
Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser
zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger
in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn
glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe
erfüllt, weshalb sie sich dann
zurückzieht. In diesem Punkt liegt
schließlich auch die Botschaft dieses
Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus
erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich
selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus
und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In
dieser Haltung verbirgt sich die Größe
Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der
Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es
blieb unbefleckt.
In der
Eucharistiefeier am 11. Februar stellt die
Liturgie Maria als Fürsprecherin in den
Vordergrund, weil sie im Volke als solche am
meisten verehrt und angerufen wird. Dies ist
bereits in dem Tagesgebet vor den Lesungen
ersichtlich: „Barmherziger Gott, ... höre auf
die Fürsprache der jungfräulichen
Gottesmutter Maria, die du vor der Erbschuld
bewahrt hast, und heile uns von aller Krankheit
des Leibes und der Seele.“ Die erste Lesung aus
dem Buch Jesaja (66,10-14c) ist ein Hymnus an die
heilige Stadt Jerusalem, in der ihre Kinder
Zuflucht und Geborgenheit finden und auch Trost
und Frieden erfahren. Im übertragenen Sinne
gilt dieser Hymnus auch für Maria, die sich
vielen als eine fürsorgliche Mutter zeigt.
Darum singt die Kirche im Antwortpsalm: „Du bist
der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels und der
Stolz unseres Volkes.“ Im Tagesevangelium (Joh
2,1-11) wird die Charakteristik Mariens als
Fürsprecherin noch um eine zweite erweitert,
nämlich Maria als die Glaubende. Darauf macht
auch der Vers vor dem Evangelium aufmerksam:
„Selig, ... du hast geglaubt ...“ In Maria bilden
Glaube und Fürsprache eine Einheit: Maria
kann Fürsprache leisten, weil sie glaubt; und
sie glaubt auch, dass ihre Fürsprache
erhört wird. Die Geschichte von der Hochzeit
zu Kana lässt klar sehen, worauf ihr Glaube
beruht und an wen sie glaubt. Sie merkt einen
Mangel und benachrichtigt ihren Sohn: „Sie haben
keinen Wein mehr!“ – Dies ist ihre
Fürsprache. Dann wendet sie sich an die
Diener und sagt: „Was er euch sagt, das tut!“ –
Hier liegt ihr Glaube. Diese beiden Sätze
sind auch die einzigen, welche Maria im
Johannesevangelium spricht. Deshalb nennt man sie
in der Exegese auch „Testament Mariens“. Die
Fürsprache und der Glaube Mariens zeigen
Wirkung und bringen Frucht: Wasser wird zu Wein.
Der Evangelist spricht vom ersten Zeichen, das
Jesus öffentlich gesetzt hat. Wir sprechen
vom ersten Wunder, das Jesus auf die
Fürsprache seiner Mutter getan hat. Das
Wunder besteht jedoch nicht darin, dass das Wasser
zu Wein wurde, sondern darin, dass die Jünger
in Jesus den Sohn Gottes erkannten und an ihn
glaubten. Darin hat auch Maria ihre Aufgabe
erfüllt, weshalb sie sich dann
zurückzieht. In diesem Punkt liegt
schließlich auch die Botschaft dieses
Gedenktages: Maria will uns helfen, dass wir Jesus
erkennen und an ihn glauben. Sie will nicht sich
selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus
und sein Wort: „Was ER euch SAGT, das tut!“ In
dieser Haltung verbirgt sich die Größe
Mariens, denn ihr Herz wurde auch von der
Sehnsucht, im Vordergrund zu stehen, bewahrt; es
blieb unbefleckt.